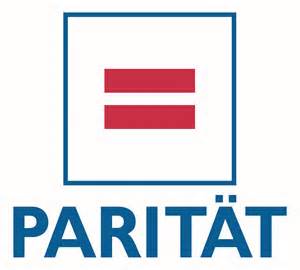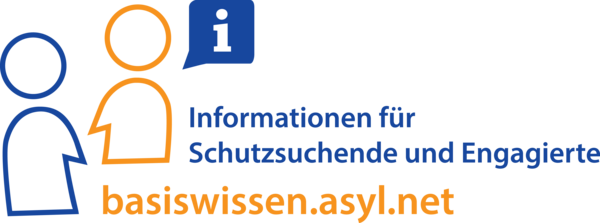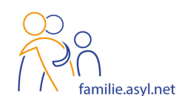Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befasst sich derzeit in einer Reihe von Verfahren mit der Zuständigkeit europäischer Staaten für Schutzsuchende (siehe unsere Meldung vom 12.7.2017). In drei dieser Vorabentscheidungsverfahren verkündete er heute seine Urteile.
Rechtssachen "Jafari" und "A.S.": Staat der Ersteinreise auch in "Ausnahmesituation" zuständig
In den Parallelverfahren Jafari gg. Österreich (Urteil vom 26.7.2017 - C-646/16 – asyl.net: M25273) und A.S. gg. Slowenien (Urteil vom 26.7.2017 – C-490/16) ging es darum, ob auch in der „Ausnahmesituation“ 2015/2016, als außergewöhnlich viele Schutzsuchende Europa erreichten, die Staaten an der Außengrenze der EU nach der Dublin-Verordnung wegen Ersteinreise für Asylsuchende zuständig wurden, obwohl sie aus humanitären Gründen ihre Grenzen öffneten und die Durchreise in andere EU-Staaten ermöglichten.
In beiden Fällen waren die Betroffenen über die sogenannte Balkanroute nach Europa geflüchtet und über die EU-Außengrenze nach Kroatien eingereist. Zwar hatten sie zuvor bereits in Griechenland erstmals EU-Boden betreten, doch weil dort „systemische Mängel“ im Asylverfahren herrschen, wurde das Land in Anwendung der Dublin-Verordnung nicht für sie zuständig. Der syrische Staatsangehörige A.S. reiste mit Unterstützung der kroatischen Behörden weiter nach Slowenien und stellte dort einen Asylantrag. Die Mitglieder der afghanischen Familie Jafari reisten ebenfalls mit einem staatlich organisiertem Bus durch Kroatien und stellten schließlich in Österreich Asylanträge.
Sowohl Slowenien als auch Österreich waren der Ansicht, dass Kroatien für die Asylverfahren der Betroffenen zuständig war, weil die Asylsuchenden in Kroatien erstmalig in das Gebiet der "Dublin-Staaten" eingereist waren. Nach Art. 13 Dublin-Verordnung ist der Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, dessen Grenze die asylsuchende Person „illegal überschritten“ hat. Unter Berufung auf diese Vorschrift drohten sie den Betroffenen an, sie nach Kroatien zu überstellen, um dort das Asylverfahren zu betreiben.
Die Betroffenen fochten die entsprechenden Entscheidungen der slowenischen und österreichischen Behörden gerichtlich an. Sie machten geltend, dass ihre Einreise nach Kroatien nicht als „illegal“ angesehen werden könnte, so dass nicht das Zuständigkeitskriterium der Ersteinreise, sondern das der erstmaligen Asylantragstellung anwendbar sei.
In den jeweiligen gerichtlichen Verfahren vor den nationalen Gerichten legten schließlich der Oberste Gerichtshof Sloweniens (Beschluss vom 14.09.2016, asyl.net: M24820 ) und der VwGH Österreich (Beschluss vom 14.12.2016, asyl.net: M24821) dem EuGH im Wege des Vorabentscheidungsersuchens die Frage vor, ob die Einreise der Betroffenen als „illegal“ im Sinne der Dublin-Verordnung anzusehen ist. Der VwGH Österreich fragte darüber hinaus, ob es sich bei der faktisch geduldeten Einreise um ein "Visum" i.S.d. Art. 2 Bst. m und Art. 12 Dublin-III-VO handelte.
Der EuGH behandelte die Sachen gemeinsam im beschleunigten Verfahren (Art. 105 EuGH VerfO). Die Generalanwältin beim EuGH, Eleanor Sharpston, kam in ihren Schlussanträgen zu dem Ergebnis, dass die Gestattung der Grenzübertritte „unter den ganz außergewöhnlichen Umständen“ dazu führte, dass die Einreise nicht als „illegal“ zu bewerten sei. Vielmehr sei derjenige Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig, in dem ein Asylantrag nach gestatteter Durchreise als erstes gestellt wurde. Dieser Auffassung der Generalanwältin folgte der EuGH in seinen heutigen Entscheidungen nicht.
Der Gerichtshof stellt zwar wie die Generalanwältin fest, dass es sich bei der faktisch geduldeten Einreise nicht um ein "Visum" i.S.d. Art. 2 Bst. m und Art. 12 Dublin-III-VO handelt und dass eine solche Einreise auch keine visafreie Einreise im Sinne des Art. 14 Dublin-Verordnung darstellt. Allerdings sei auch die Einreise, die aufgrund einer außergewöhnlich hohen Zahl von Schutzsuchenden aus humanitären Gründen zur Durchreise geduldet wird, als "illegal" im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO einzustufen, so das das Zuständigkeitskriterium der ersten Einreise anwendbar ist.
Der EuGH betont jedoch, dass andere Mitgliedsstaaten im "Geist der Solidarität" vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Dublin-III-VO Gebrauch machen können, auch wenn sie nach den Zuständigkeitskriterien nicht zuständig sind. Schließlich weist er darauf hin, dass Asylsuchende nicht an den zuständigen Mitgliedstaat überstellt werden dürfen, wenn ihnen dort infolge einer außergewöhnlich hohen Zahl an ankommenden Schutzsuchenden eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht.
Rechtssache "Mengesteab": Asylsuchende können sich auf Ablauf der Aufnahmegesuchsfrist berufen
In der weiteren Entscheidung von heute – in der Rechtssache Mengesteab gg. Deutschland (Urteil vom 26.07.2017 - C-670/16 – asyl.net: M25274) – befasste sich der EuGH mit der Anwendung der Dublin-Verordnung im regulären Dublin-Verfahren. In diesem Fall ging es um die Rechte von Asylsuchenden im Dublin-Verfahren und insbesondere um die Frage, ob sich Asylsuchende auf den Ablauf der Frist zur Stellung eines Übernahmeersuchens berufen können und ab wann diese Frist zu laufen beginnt.
In dem vorliegenden Fall hatte ein Asylsuchender aus Eritrea bei einer Behörde in Bayern im September 2015 um Asyl nachgesucht und eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender erhalten. Das für Asylverfahren in Deutschland zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde spätestens im Januar 2016 darüber informiert. Erst im Juli 2016 konnte der Betroffene aber beim BAMF vorsprechen und einen förmlichen Asylantrag stellen. Eine sogenannte Eurodac-Abfrage (Abgleich der Fingerabdrücke in einer europaweiten Datenbank) ergab, dass er bereits in Italien registriert worden war. Das BAMF lehnte daher den Asylantrag als unzulässig ab. Diese Entscheidung focht der Betroffene vor dem VG Minden an. Das VG Minden ersuchte den EuGH in diesem Rahmen um eine Vorabentscheidung (Beschluss vom 22.12.2016 - 10 K 5476/16.A – asyl.net: M24535, Asylmagazin 4/2017). Es fragte den Gerichtshof, ob sich Asylsuchende auf den Ablauf der Frist für die Stellung des Übernahmeersuchens berufen können und ob diese Frist schon ab Asylgesuch oder erst ab förmlicher Asylantragstellung zu laufen beginnt.
Hintergrund der Anfrage ist der Streit darum, aus welchen Bestimmungen der Dublin-Verordnung sich "subjektive" Rechte ableiten lassen – sich also auch die Betroffenen selbst auf bestimmte Regelungen der Verordnung berufen können, die für sie günstig sind. Nach der entgegenstehenden Auffassung regeln die Bestimmungen der Dublin-Verordnung nur die Beziehungen der Staaten untereinander, weshalb sich subjektive Rechte nicht aus der Dublin-Verordnung direkt ableiten ließen. Der EuGH hatte hierzu in der Vergangenheit verschiedene Ansätze verfolgt: Zunächst hatte er (noch in Bezug auf die alte Dublin-II-Verordnung) grundsätzlich verneint, dass Asylsuchende aus der Verordnung subjektive Rechte ableiten können (Urteil vom 10.12.2013 - C-394/12, Abdullahi gegen Österreich – asyl.net: M21347). Später hatte er dies aber in Bezug auf einzelne Regelungen der Dublin-III-Verordnung bejaht (EuGH, Urteile vom 07.06.2016, Ghezelbash, C-63/15, asyl:net: M23883 und Karim, C-155/15, asyl.net: M23884; Ausführlich hierzu siehe hierzu Heiko Habbe, Asylmagazin 7/2016, S. 206 ff.).
Der EuGH stellte in seiner heutigen Entscheidung fest, dass Asylsuchende sich auf die Dublin-III-Verordnung berufen können, wenn die Frist für die Stellung eines Übernahmeersuchens nach Art. 21 Abs. 1 UAbs. 3 Dublin-III-VO abgelaufen ist. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass Herr Mengesteab geltend machen kann, dass das Übernahmeersuchen Deutschlands an Italien nicht wirksam gestellt wurde, weil es zu spät kam. In diesem Zusammenhang befand der EuGH, dass ein Übernahmeersuchen nach Ablauf von drei Monaten nach Stellung eines Asylgesuchs nicht mehr wirksam erfolgen kann, auch wenn dies weniger als zwei Monate nach Erhalt einer Eurodac-Treffermeldung geschieht. Schließlich stellte er fest, dass die in Art. 21 Abs. 1 UAbs. 1 Dublin-III-VO geregelte Frist für die Stellung von Übernahmeersuchen auch vor der Stellung eines förmlichen Asylantrags zu laufen beginnt, wenn ein sogenanntes Asylgesuch vorliegt (also die Erklärung, Asyl beantragen zu wollen, bei der Polizei oder einer anderen Behörde) und wenn die zuständige Behörde (hier das BAMF) nachweislich darüber informiert wurde, dass ein solches Asylgesuch gestellt wurde.Im Fall von Herrn Mengesteab hätte das BAMF also innerhalb von drei Monaten, nachdem es vom Vorliegen seines Asylgesuchs Kenntnis erlangt hatte, das Übernahmeersuchen an Italien richten müssen. Zum Zeitpunkt der förmlichen Asylantragstellung war diese Frist also bereits abgelaufen.