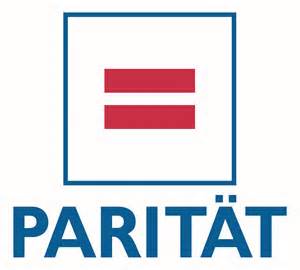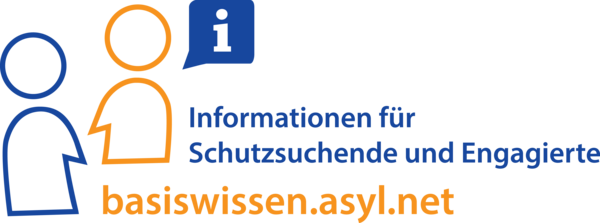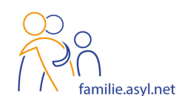Hintergrund: Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan
Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan (BAP) startete im Oktober 2022 und sollte besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen sowie ihren Familienangehörigen eine Aufnahme in Deutschland ermöglichen. Die Bundesregierung gibt auf der Webseite zum BAP an, dass etwa 45.000 besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen sowie ihren berechtigten Familienangehörigen die Aufnahme in Aussicht gestellt wurde. Hierzu zählen insbesondere über 25.100 ehemalige afghanische Ortskräfte und ihre Familienangehörige sowie weitere über 19.900 besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen, die die Bundesregierung mithilfe der Zivilgesellschaft identifiziert hat und die wegen ihres Engagements für ein demokratisches Afghanistan einer besonderen individuellen Gefährdung ausgesetzt seien. Es seien bisher über 33.200 Personen eingereist. Darunter befänden sich über 20.300 Ortskräfte einschließlich Familienangehörigen sowie über 12.900 weitere besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen, einschließlich Familienangehörigen (Stand: April 2024).
Einem Rechtsgutachten zufolge, dass Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte e.V. eingeholt haben (s.u.), befinden sich derzeit noch 2.351 afghanische Staatsangehörige in Pakistan, denen eine Aufnahmezusage erteilt wurde und die auf die Ausreise nach Deutschland warten.
Der Beschluss des VG Berlin
In dem nun ergangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin (7. Juli 2025 - VG 8 L 290/25 V) handelt es sich um afghanische Staatsangehörige, die sich derzeit in Pakistan aufhalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilte den Antragsteller*innen im Oktober 2023 sogenannte Aufnahmezusagen, woraufhin die Antragsteller*innen bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Islamabad Visa zur Einreise ins Bundesgebiet beantragten. Diese wurden bisher allerdings noch nicht erteilt. Aus dem Beschluss geht hervor, dass die Antragsteller*innen mit ihrem gerichtlichen Eilantrag geltend machen, dass sie einen Anspruch auf Visumserteilung hätten und nicht länger in Pakistan bleiben könnten. Ihnen drohe dort die Abschiebung nach Afghanistan, wo sie um Leib und Leben fürchten müssten.
Das Gericht hat entschieden, dass die Visa an die Antragsteller*innen erteilt werden müssen. Zwar könne die Bundesrepublik bestimmen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen sie das Aufnahmeprogramm für afghanische Staatsangehörige beenden oder fortführen wolle. Sie könne während dieses Entscheidungsprozesses insbesondere von der Erteilung neuer Aufnahmezusagen absehen. Sie habe sich jedoch durch bestandskräftige, nicht widerrufene Aufnahmezusagen rechtlich gebunden. Die Aufnahmezusage des BAMF sei keine behördliche Mitteilung ohne Außenwirkung. Der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Aufnahmebescheid, der an die Antragsteller*innen ausgehändigt wurde, sei ein Verwaltungsakt im Sinne von § 35 S. 1 VwVfG (siehe zur Tenorierung des Bescheids die Rn. 4 bis 7 des Beschlusses).
Von dieser freiwillig eingegangenen und weiter wirksamen Bindung könne sich die Bundesrepublik Deutschland nicht lösen. Auf diese rechtliche Bindung könnten sich die Antragsteller*innen berufen. Zudem erfüllten die Antragsteller*innen die weiteren Voraussetzungen für die Visumserteilung, insbesondere sei hinsichtlich der Lebensunterhaltssicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG von einem Ausnahmefall auszugehen, weil Sinn und Zweck der ausschließlich auf humanitären Gründen beruhenden Aufnahmezusage ein Absehen von dieser Erteilungsvoraussetzung gebieten würde. Es seien auch keine Sicherheitsbedenken ersichtlich und ihre Identität sei geklärt. Schließlich hätten sie auch glaubhaft gemacht, dass ihnen eine Abschiebung von Pakistan nach Afghanistan drohe, wo ihnen Gefahr für Leib und Leben bevorstehe.
Gegen den Beschluss kann Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.
Rechtsgutachten zur möglichen strafrechtlichen Verantwortung deutscher Stellen im Zusammenhang mit dem BAP
Beinahe zeitgleich mit der Entscheidung des VG Berlin wurde ein Gutachten veröffentlicht, das im Auftrag von Pro Asyl und dem Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte erstellt wurde. Der Autor, Rechtsanwalt Dr. Robert Brockhaus, befasst sich dabei mit der Situation der 2.351 Personen, denen eine Aufnahmezusage erteilt wurde und die sich aktuell noch in Pakistan aufhalten. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die Betroffenen in Pakistan unmittelbar von Festnahmen und Abschiebungen nach Afghanistan bedroht sind, wo ihnen Misshandlungen, Folter und Tötungen durch die Taliban drohen würden. Mehrfach seien bereits Menschen mit Aufnahmezusagen aus Deutschland in Pakistan festgenommen worden. In wenigen Fällen seien die Betroffenen anschließend nach Afghanistan abgeschoben worden, zumeist habe die deutsche Botschaft aber aufgrund einer Vereinbarung mit der pakistanischen Regierung die Abschiebung noch verhindern können. Falls Deutschland das Aufnahmeprogramm beende oder die bereits erteilten Zusagen zurückziehe, sei zu erwarten, dass die Vereinbarung mit der pakistanischen Regierung nicht mehr greife und weitere Abschiebungen stattfinden würden. Aufgrund zahlreicher Berichte internationaler Organisationen und von Medienrecherchen könne belegt werden, dass die Betroffenen im Fall der Abschiebung Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt seien.
Auf der Grundlage dieser Lagebeschreibung setzt sich das Gutachten anschließend mit der Frage auseinander, ob die beteiligten deutschen Stellen aufgrund der Aufnahmezusagen verpflichtet sind, Gefahren oder Schäden von den betroffenen Personen abzuwenden und ob sie sich gegebenenfalls strafbar machen, wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Im Ergebnis wird festgestellt, dass hier deutsches Strafrecht auf die Handlungen bzw. das Unterlassen von Handlungen durch die verantwortlichen deutschen Stellen sowie die beteiligten Beamt*innen anwendbar wäre. Sie seien verpflichtet, bevorstehende Abschiebungen der Personen, für die eine Aufnahmezusage erteilt wurde, von Pakistan nach Afghanistan zu verhindern. Auch seien sie verpflichtet, andere Handlungen zu unterlassen, in deren Folge Abschiebungen der Betroffenen stattfinden würden. Falls die deutschen Vertreter*innen diesen Pflichten nicht nachkämen, würden sie sich insbesondere dadurch strafbar machen, dass sie die Betroffenen vorsätzlich in eine hilflose Lage versetzen würden (sogenannte Aussetzung, § 221 StGB). Daneben käme auch eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung sowie weiterer Delikte in Betracht.