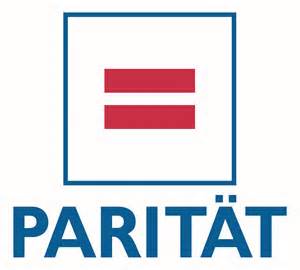Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten
Im Juli 2025 wurde der Familiennachzug nach § 36a AufenthG "bis zum Ablauf des 23. Juli 2027" ausgesetzt. Der § 36a AufenthG, der den Familiennachzug zu Personen mit subsidiärem Schutzstatus regelt und der bereits eine Begrenzung von monatlich 1.000 zu diesem Zweck erteilten Visa vorgesehen hatte, wurde damit für zwei Jahre vollständig außer Kraft gesetzt (siehe die Meldung auf asyl.net vom 23. Juli 2025).
Dies hat zur Folge, dass den Angehörigen von subsidiär schutzberechtigten Personen in diesem Zeitraum nur noch in Ausnahmefällen ein Visum zum Familiennachzug erteilt werden kann, und zwar bei Vorliegen dringender humanitärer Gründe oder "zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland" nach §§ 22 und 23 AufenthG. Laut Gesetzesbegründung soll durch den ausdrücklichen Verweis auf diese Regelungen sichergestellt sein, dass eine Familienzusammenführung weiterhin möglich ist und so den verfassungs-, völker- und europarechtlichen Vorgaben Rechnung getragen werde.
Im Gesetzgebungsverfahren wurde bereits von zahlreichen Organisationen bezweifelt, dass der Verweis auf die §§ 22 und 23 AufenthG geeignet sei, um eine effektive Prüfung von möglichen Härtefällen zu ermöglichen. So habe sich während der Aussetzung des Familiennachzugs zwischen 2016 und 2018 gezeigt, dass die Hürden für die Anwendung der Regelung des § 22 Abs. 1 AufenthG (dringende humanitäre Gründe) sehr hoch gewesen seien. Eine überprüfbare, am Einzelfall orientierte Entscheidung, die für eine grund- und menschenrechtskonforme Praxis notwendig sei, sei mit dieser Regelung nicht garantiert (siehe stellvertretend für zahlreiche weitere die schriftliche Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbands vom 19. Juni 2025, Ausschussdrucksache 21(4)012 G).
Weisung des Auswärtigen Amtes
Aus der nunmehr von FragDenStaat veröffentlichten Weisung des Auswärtigen Amtes (AA) geht hervor, welche Kriterien bei der Prüfung von Härtefallen angelegt werden. So wird beispielsweise eine Trennung von Kleinkindern von Eltern, die den Zeitraum von fünf Jahren überschreite, als nicht mehr mit Art. 6 GG und Art. 8 EMRK vereinbar angesehen. Bei Familien mit Kindern über drei Jahre wird eine Trennungsdauer von etwa zehn Jahren als nicht mehr vertretbar angesehen.
Als weitere Härtefälle werden schwere, nur im Bundesgebiet zu behandelnde Krankheiten der antragstellenden Personen genannt, eine dringende Gefahr für Leib und Leben der antragstellenden Person oder ein in Kürze bevorstehender Tod. In der Weisung wird darauf verwiesen, dass die Aufzählung nicht abschließend sei. Die "Sondersituation", in der sich die betroffenen Personen befänden, müssten sich aber "deutlich von der Lage vergleichbarer ausländischer Personen" unterscheiden. So sttelle der Umstand, dass ein Kleinkind von seinen in Deutschland lebenden Eltern getrennt werde, für sich genommen keinen Härtefall dar, weil die Vergleichsgruppe zu groß sei. Vielmehr müsse ein weiterer Umstand hinzutreten, wie beispielsweise eine Gefährdung.
Kritik
Pro Asyl verweist in einer Nachricht vom 18.9.2025 darauf, dass die Regelung soziale und psychische Belastungen verschärfe und dem Schutz von Ehe und Familie nach dem Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspreche. Kindeswohlerwägungen fänden gar keine Erwähnung in der Weisung und einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sei nicht berücksichtigt worden.