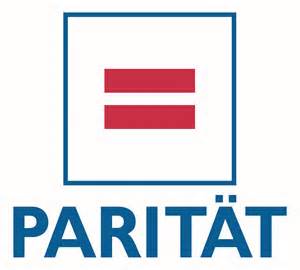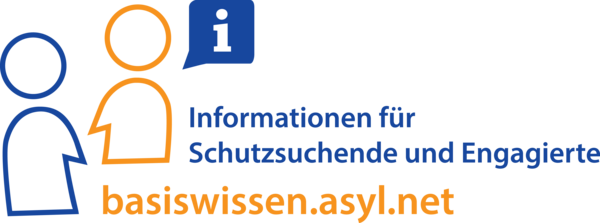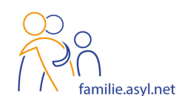Hintergrund: Die Begriffe "Betreten" oder "Durchsuchen" im Aufenthaltsgesetz
Mit dem "Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" war im Jahr 2019 der Begriff des "Betretens" von Wohnungen in das Aufenthaltsgesetz (§ 58 Abs. 5 AufenthG) eingeführt worden. Das "Betreten" eines Wohnraums ist demnach ohne eine richterliche Anordnung möglich, wenn sie dem Zweck der "Ergreifung des abzuschiebenden Ausländers" dient und "wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass sich der Ausländer dort befindet." Daneben wird im Aufenthaltsgesetz auch noch die "Durchsuchung" als weitere Maßnahme definiert, die zum Zweck der Durchführung der Abschiebung (§ 58 Abs. 6 AufenthG) notwendig sein kann. Nur für die Durchsuchung soll dabei eine richterliche Anordnung nötig sein oder es muss "Gefahr im Verzug" bestehen (§ 58 Abs. 8 AufenthG). Ob das "Betreten" einer Wohnung ohne richterlichen Beschluss damit grundrechtskonform geregelt war und wie die beiden Begriffe des "Betretens" und des "Durchsuchens" sinnvoll voneinander abgegrenzt werden können, war von Beginn an umstritten (siehe hierzu den Beitrag von Heiko Habbe, Der (un-?) geschützte Wohnraum – Betretens- und Durchsuchungsrechte der Behörden in Flüchtlingsunterkünften, in: Das Migrationspaket, Beilage zum Asylmagazin 8–9/2019, S. 55ff.).
Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit
In dem nun dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorliegenden Fall hatte die Polizei am 10. September 2019 einen guineischen Staatsangehörigen, der nach Italien abgeschoben werden sollte, in einer aus Containern bestehenden Gemeinschaftsunterkunft in Berlin aufgegriffen. Dafür war die verschlossene Zimmertür mit einer Ramme aufgebrochen worden. Die beiden Personen, die sich im Zimmer aufhielten, seien anschließend dazu aufgefordert worden, sich auszuweisen. Der Betroffene wandte sich gegen die Maßnahme unter anderem mit dem Argument, dass sein Zimmer nicht hätte betreten und durchsucht werden dürfen.
Das Verwaltungsgericht Berlin gab in der ersten Instanz dem Betroffenen insofern recht, als es feststellte, dass die Maßnahme der Polizei eine Durchsuchung dargestellt hätte und daher wegen einer fehlenden richterlichen Durchsuchungsanordnung rechtswidrig gewesen sei. Entscheidend hierfür sei gewesen, dass es für die anwesenden Mitarbeitenden der Behörden und der Polizei nicht absehbar gewesen sei, ob sich der Gesuchte im Zimmer aufgehalten hätte und welcher Aufwand nötig gewesen wäre, um ihn zu finden (VG Berlin, Urteil vom 4. Oktober 2021 – 10 K 383.19 – Asylmagazin 1-2/2022 ff., asyl.net: M30091). Dass das Zimmer nach dem Öffnen gut einsehbar gewesen sei, sei dabei nicht von Bedeutung. Es komme nämlich nicht darauf an, was die Beamt*innen letztlich vorgefunden hätten, sondern darauf, was sie sich bei der Vorbereitung der Maßnahme vorgestellt hätten. Andernfalls wäre die Abgrenzung von "Betreten" und "Durchsuchen" von zufälligen Umständen wie der Größe und Überschaubarkeit des Wohnraums abhängig.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sah dies im Berufungsverfahren anders und hob die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf. Die Polizei habe demnach bei dem Einsatz in der Gemeinschaftsunterkunft das Zimmer lediglich betreten und nicht durchsucht. Die "beim Betreten der Wohnung unvermeidliche Kenntnisnahme von Personen, Sachen und Zuständen" stelle noch keine Durchsuchung dar. Solange keine Suchhandlung stattfinde, sei es auch unerheblich, zu welchem Zweck das Betreten der Wohnung erfolgt sei (Urteil vom 27. Februar 2024 - OVG 3 B 17/22 - asyl.net: M32502).
Mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und von Pro Asyl wandte sich der Betroffene im Februar 2025 mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Revision nicht zugelassen hatte.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 30. September 2025 (Link siehe unten) das genannte Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg aufgehoben und zugleich Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Januar 2025 – BVerwG 1 B 20.24 – und vom 13. Februar 2025 – 3 B 17/22 –, in denen die Revision bzw. eine Anhörungsrüge zurückgewiesen worden waren, für gegenstandslos erklärt.
Zur Begründung führt das BVerfG aus, dass es sich jedenfalls im vorliegenden Fall um eine Durchsuchung gehandelt habe, für die eine richterliche Anordnung notwendig gewesen wäre. Auszugehen sei dabei vom Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 GG (Richtervorbehalt bei Durchsuchungen), in dem weder nach den Formen der Durchsuchung noch nach verschiedenen Anwendungsgebieten differenziert werde. Auch verwaltungsbehördliche Durchsuchungen – wie hier im Bereich des Aufenthaltsrechts – seien somit ohne Weiteres vom Anwendungsbereich des Grundgesetzes umfasst. Dementsprechend könnten Grundsätze, die in anderen Rechtsgebieten zur Durchsuchung entwickelt worden seien, auch hier angewandt werden. Somit gelte, dass eine Durchsuchung dann nicht vorliege, wenn der Staat in eine Wohnung oder in Geschäftsräume nur zum Zweck der Informationsgewinnung eindringe. Ebenso könne eine Maßnahme unterhalb der Schwelle zur Durchsuchung liegen, wenn "das Betreten der Wohnung lediglich das Mittel ist, um ein bereits ausgemachtes Ziel zu erreichen, das heißt, wenn den staatlichen Organen bereits bekannt ist, auf welchen Gegenstand sich ihre Maßnahme bezieht und an welcher Stelle sich dieser befindet" (Rn. 39 des Beschlusses des BVerfG vom 30.9.2025, Link siehe unten).
Demgegenüber liege grundsätzlich eine Durchsuchung vor, wenn eine betroffene Person zum Zweck der Abschiebung in seinem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgesucht werde, solange vor Beginn der Maßnahme keine sichere Kenntnis über den konkreten Aufenthaltsort der betroffenen Person bestanden habe. In diesem Fall ziele die Maßnahme nämlich darauf ab, dass ein nicht bekannter Umstand (der genaue Aufenthaltsort des Betroffenen) ergründet werden solle. Behörden und Polizei befänden sich bei der Planung der Abschiebung regelmäßig im Unklaren darüber, ob eine Suchhandlung nötig sein werde, "zumindest kann dies zumeist nicht mit der erforderlichen Sicherheit prognostiziert werden" (Rn. 41 des Beschlusses des BVerfG vom 30.9.2025, Link siehe unten). Bei einer geplanten Ergreifung im Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft zum Zweck der Abschiebung sei daher vorab eine richterliche Anordnung einzuholen. Der Schutzzweck des Art. 13 Abs. 2 GG drohe sonst leerzulaufen.
Deutlich zurückgewiesen wird in der Entscheidung des BVerfG die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts (auf die sich auch das OVG Berlin-Brandenburg gestützt hatte), wonach es bei der Abgrenzung von "Betreten" und "Durchsuchen" darauf ankomme, ob nach dem Betreten der Wohnung "etwas nicht klar zutage Liegendes, vielleicht Verborgenes" aufgedeckt werde. Solange dies nicht der Fall sei und lediglich eine beim Betreten der Wohnung "unvermeidliche Kenntnisnahme von Personen, Sachen und Zuständen" erfolge, hätte es sich nach Auffassung des BVerwG nicht um eine Durchsuchung gehandelt (BVerwG, Urteil vom 15.6.2023 – 1 C 10.22 – Asylmagazin 12/2023, S. 450 ff., asyl.net: M31858, siehe zur Kritik an dieser Entscheidung auch den Beitrag von Justus Linz, Im Zweifel gegen den Richter*innenvorbehalt? AM 12/2023, S. 399-404).
Das BVerfG sieht in diesem vom BVerwG aufgestellten Grundsatz "kein tragfähiges, zuverlässiges Kriterium für die Abgrenzung einer Durchsuchung von einem Betreten". Die vom BVerwG vorgenommenen Unterscheidung führe zu zufälligen Ergebnissen, da sie es von der vorgefundenen Situation abhängig mache, ob eine richterliche Anordnung erforderlich sei oder nicht. Wann eine "Kenntnisnahme" in eine Durchsuchung umschlage, habe das BVerwG offengelassen. Geboten sei es demgegenüber, dass die Maßnahme von ihrem Beginn an (nicht erst rückwirkend anhand ihres Verlaufs) in den Blick genommen werde. Im vorliegenden Fall sei der Polizei zum Zeitpunkt des Aufbrechens der Zimmertür aber nicht bekannt gewesen, ob sich die gesuchte Person überhaupt in dem Zimmer aufgehalten hätte. Das Betreten des Zimmers habe eindeutig dem Ziel gedient, diese Person aufzuspüren und zu ergreifen. Dabei handele es sich um einen Grundrechtseingriff, da "auf einen zur Wohnung gehörenden Umstand in einer Weise - unangekündigt - zugegriffen [wird], welche in der Lage ist, die der freien Persönlichkeitsentfaltung dienende Sphäre erheblich zu beeinträchtigen."
Vor diesem Hintergrund stellt das BVerfG fest, dass das OVG Berlin-Brandenburg die Anforderungen des Grundrechtsschutzes nach Art. 13 Abs. 2 GG verfehlt habe, indem es das Vorgehen der Polizei nicht als Durchsuchung, welche eine richterliche Anordnung erfordert hätte, eingestuft habe. Die Sache wird an das OVG Berlin-Brandenburg zurückverwiesen.
Mögliche Auswirkungen
In einer ersten Stellungnahme wies der Rechtsanwalt des Beschwerdeführers, Christoph Tometten, auf die grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hin: Solange die Polizei vor Beginn der Abschiebungsmaßnahme keine sichere Kenntnis darüber habe, wo sich die gesuchte Person konkret aufhalte, sei künftig ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erforderlich. Laut seiner Einschätzung bleibt damit für die gesetzliche Konstruktion des "Betretens" in § 58 Abs. 5 AufenthG in der Praxis "nahezu kein Anwendungsbereich mehr" (Pressemitteilung von Pro Asyl, Link siehe unten).