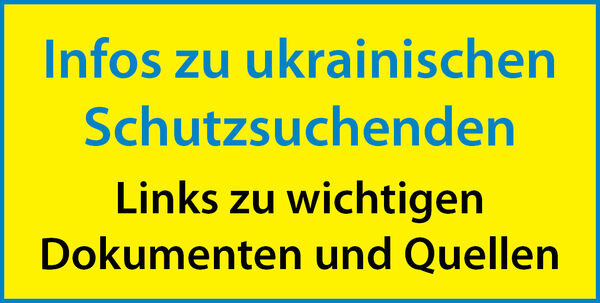Am 4. März 2022 trat ein Beschluss der EU-Staaten („Durchführungsbeschluss 2022/382 des Rates“; https://t1p.de/23c51) in Kraft, demzufolge Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, ein Schutzstatus durch die EU-Mitgliedsstaaten gewährt wird. Dieser „vorübergehende Schutz“ basiert auf der EU-Richtlinie 2001/55/EG (https://t1p.de/8xci) und ist zuvor noch nie zur Anwendung gekommen. Erfasst sind neben Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in manchen Fällen auch nicht-ukrainische Staatsangehörige, die sich zu Beginn des Kriegs in der Ukraine aufgehalten haben - allerdings wurden die Regelungen für diesen Personenkreis stark eingeschränkt.
Während für ukrainische Geflüchtete der vorübergehende Schutz und die Geltung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG um ein weiteres Jahr bis zum 4. März 2026 verlängert worden sind, gilt dies für viele aus der Ukraine Geflüchtete ohne ukrainische Staatsangehörigkeit nicht (mehr): Wenn sie in der Ukraine nur einen befristeten Aufenthaltstitel besaßen, sollen sie nach dem Willen der Bundesregierung in vielen Fällen ab dem 5. März 2025 keine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG mehr erhalten – selbst wenn sie vorher schon in deren Besitz waren.
Der Zeitdruck ist hoch, bis dahin Alternativen zu suchen, mit denen die Betroffenen dennoch eine Bleibeperspektive in Deutschland erhalten können. Die Möglichkeiten sollen in dieser Arbeitshilfe dargestellt werden. Außerdem sollen die aktuell geltenden Regelungen noch einmal grundsätzlich erläutert werden.
Autor: Claudius Voigt, GGUA Flüchtlingshilfe Münster
Stand: 15.1.2025
Die Möglichkeiten zur Einreise sind geregelt in der „Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung“, die zuletzt bis zum 4. März 2026 verlängert worden ist (https://t1p.de/6o4zi). Die Verordnung ist insbesondere für Menschen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit schrittweise immer weiter verschärft worden.
Demnach gilt: Die erstmalige Einreise aus der Ukraine und der Aufenthalt für 90 Tage sind unter bestimmten Voraussetzungen ohne Visum rechtmäßig. Ein anschließender Aufenthaltstitel kann in Deutschland beantragt werden.
Nach § 2 der ab 22. November 2024 geltenden Fassung gilt eine Befreiung von der Visumpflicht für folgende Gruppen:
Für Menschen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit gilt dies nur, wenn sie
Für nicht-ukrainische Personen mit befristetem Aufenthaltstitel in der Ukraine gilt die visumfreie Einreise also nicht mehr. Dies ist jedoch erst seit einer Verschärfung zum 5. März 2024 so: Personen mit befristetem Aufenthaltstitel in der Ukraine, die vor dem 5. März 2024 eingereist sind, durften noch ohne Visum einreisen. Ein Visumverstoß kann ihnen daher nicht vorgeworfen werden, die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels würde hierdurch (auch später) nicht gesperrt.
Nach § 3 der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung können die genannten Gruppen während des rechtmäßigen Aufenthalts einen längerfristigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet beantragen, ohne ein Visumverfahren zu durchlaufen. Es wird dabei nicht wie sonst regelmäßig geprüft, ob es zumutbar ist, das Visumverfahren aus einem anderen Staat (z.B. dem ursprünglichen Herkunftsstaat) nachzuholen. Dies kann insbesondere wichtig sein für nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige und auch für Ukrainer*innen, die in Deutschland z.B. die regulären Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus familiären Gründen, als Fachkraft, für das berufliche Anerkennungsverfahren, für eine Ausbildung oder für das Studium erfüllen.
Der Aufenthalt ist nur 90 Tage rechtmäßig. Daher sollte innerhalb dieser Zeit eine Aufenthaltserlaubnis beantragt werden. Der Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis führt dazu, dass sich der erlaubte Aufenthalt verlängert (§ 81 Abs. 3 S. 1 AufenthG) und eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden muss. Wenn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt worden ist, führt dies dazu, dass der Aufenthalt nicht mehr rechtmäßig ist.
Am 4. März 2022 trat ein Beschluss der EU-Staaten („Durchführungsbeschluss 2022/382 des Rates“; https://t1p.de/23c51) in Kraft, demzufolge Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, ein Schutzstatus durch die EU-Mitgliedsstaaten gewährt wird. Dieser „vorübergehende Schutz“ basiert auf der EU-Richtlinie 2001/55/EG (https://t1p.de/8xci) und ist zuvor noch nie zur Anwendung gekommen.
Der vorübergehende Schutz ist am 25. Juni 2024 um ein weiteres Jahr verlängert worden und gilt nun bis zum 4. März 2026 (https://t1p.de/bpy7j).
Der Beschluss der EU über den vorübergehenden Schutz umfasst nach Art. 2 Abs. 1 folgenden Personenkreis:
Darüber hinaus werden in Art. 2 Abs. 2 des Ratsbeschlusses die Mitgliedstaaten verpflichtet, auch anderen Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die sich vor dem 24. Februar mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten haben, den vorübergehenden Schutz oder einen anderen nationalen Schutzstatus zu erteilen, sofern diese Personen nicht in ihre Herkunftsländer oder Herkunftsregionen „sicher und dauerhaft“ zurückkehren können.
Der Ratsbeschluss stellt es außerdem in das Ermessen der Mitgliedstaaten, auch anderen Personen vorübergehenden Schutz zu gewähren, insbesondere Drittstaatsangehörigen, die sich mit einem befristeten Status in der Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können. Auch für ukrainische Staatsangehörige, die „nicht lange“ vor dem 24. Februar 2022 bereits in der EU waren, sieht der Ratsbeschluss die Möglichkeit des vorübergehenden Schutzes vor.
Wer in Deutschland vom vorübergehenden Schutz erfasst sein soll, regelt aktuell ein Schreiben des Bundesinnenministeriums vom 30. Mai 2024 (https://t1p.de/ei5gf). Danach erhalten neben den ohnehin erfassten ukrainischen Staatsangehörigen folgende Personen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit den vorübergehenden Schutz, und zwar ohne eine Prüfung der Möglichkeit der Rückkehr ins ursprüngliche Herkunftsland:
Auch die Familienangehörigen von nicht-ukrainischen Staatsangehörigen mit unbefriststem Aufenthaltstitel in der Ukraine sind vom vorübergehenden Schutz erfasst: Aus dem Wortlaut des EU-Beschlusses oder der Fortgeltungsverordnung geht dies zwar nicht hervor. Das BMI schreibt allerdings in seinem Schreiben (https://t1p.de/ei5gf) auf S. 5 folgendes:
„Für Familienangehörige anspruchsberechtigter Personen nach Artikel 2 Absatz 2 des Durchführungsbeschlusses (Anmerkung: dazu gehören auch die mit unbefristetem Titel), denen nicht bereits unter den Voraussetzungen der Ziffer 1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zusteht, gelten die unter Nummer 1. c) genannten Voraussetzungen.“
Unter der Nr. 1c) geht es um die bekannte Definition der Familienangehörigen von ukrainischen Personen oder Personen mit internationalem Schutz. Übersetzt kann das nur heißen: Das BMI überträgt das Aufenthaltsrecht für Familienangehörige von Ukrainer*innen oder International Schutzberechtigten auf Familienangehörige von Personen mit unbefristetem Titel. Somit haben auch diese nach Auffassung des BMI weiterhin einen Anspruch auf § 24. Da die Fortgeltungsverordnung dies nicht ausdrücklich regelt, sollte man bei der ABH die ausdrückliche Ausstellung bzw. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis beantragen und auf die Formulierung in dem BMI-Rundschreiben verweisen.
Zu der Frage, was unter einem "internationalen oder gleichwertigen nationalen Schutzstatus" zu verstehen ist, erläutert das BMI in dem erwähnten Schreiben: "Gemeint ist der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder ein mit dem subsidiären Schutz vergleichbarer Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU sowie ein gleichwertiger nationaler Schutz. Die Vorlage eines ukrainischen Reiseausweises für Flüchtlinge oder Reisedokument über den komplementären Schutz („Travel Document for Person Granted Complementary Protection“) gilt als ausreichender Nachweis des Schutzstatus." (S. 3)
Unter „Familienangehörigen“ sind zu verstehen:
Die Definition dieser erweiterten Familie inkl. der nicht-verheirateten Partner*innen orientiert sich hierbei in Anlehnung an Art. 2 Nr. 2 und Art. 3 Abs. 2 der Unionsbürgerrichtlinie (RL 2004/38/EG) sowie an § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU. Zur Auslegung der jeweiligen Begriffe können hilfreich sein die „Anwendungshinweise des BMI zur Umsetzung des Gesetzes zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften an das Unionsrecht“ vom 22.1.2021 (https://t1p.de/ed2sn).
Die Familienangehörigen sind auch dann einbezogen, wenn sie als Drittstaatsangehörige ohne die*den ukrainische*n „Stammberechtigte*n“ nach Deutschland einreisen, z. B., weil der ukrainische Ehemann nicht ausreisen durfte.
„Diese (…) Familienangehörigen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG aus eigener Berechtigung aufgrund des Durchführungsbeschlusses; dabei müssen die unter Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Personen (Anmerkung: dies sind die ukrainischen „Stammberechtigten“) sich noch nicht im Bundesgebiet aufhalten.“ (Schreiben des BMI vom 30. Mai 2024, S. 3, https://t1p.de/ei5gf).
Personen, die „kurz vor“ bzw. „nicht lange“ vor dem 24. Februar 2022 schon z. B. als Tourist*innen in der EU waren (nach BMI-Auffassung soll darunter ein Zeitraum von höchstens 90 Tagen zu verstehen sein) können ebenfalls unter den oben genannten Bedingungen den vorübergehenden Schutz erhalten. Die Bundesregierung hat mittlerweile klargestellt, dass dies analog auch für Drittstaatsangehörige gilt, die sich zu diesem Zeitpunkt kurzfristig in einem Nicht-EU-Staat aufgehalten haben (https://t1p.de/ew6lg).
In Deutschland können - allerdings unter Umständen erst nach einer Prüfung der "Rückkehrmöglichkeit" - außerdem folgende Personen den vorübergehenden Schutz erhalten:
"von einer maßgeblichen Verbindung in der Ukraine und damit davon auszugehen, dass sie nicht in der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückzukehren, weil eine engere (Wortlaut der Kommission: „sinnvollere“) Bindung zur Ukraine besteht als zum Herkunftsstaat.“ (BMI, Schreiben vom 30. Mai 2024, S. 5, https://t1p.de/ei5gf). Dies gilt ausdrücklich z. B. auch für die drittstaatsangehörigen Elternteile eines ukrainischen Kindes, wenn diese einen unbefristeten Aufenthaltstitel hatten.
Eine zusätzliche Prüfung der Rückkehrmöglichkeit soll demnach nur in sehr wenigen Ausnahmefällen stattfinden dürfen, nämlich wenn die Ausländerbehörde im Einzelfall die „engere“ Bindung an die Ukraine individuell widerlegt hat. Dies dürfte in der Praxis selten vorkommen. Im Klartext heißt das: Drittstaatsangehörige mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine haben praktisch immer einen Anspruch auf den § 24 AufenthG in Deutschland.
Falls im Einzelfall doch eine Prüfung der Rückkehrmöglichkeit durchgeführt werden sollte, gilt folgendes: Nach Vorgaben der Bundesregierung können als Maßstab für diese Prüfung die Voraussetzungen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG bzw. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Duldung herangezogen werden. Dies bedeutet, dass unter anderem folgende Aspekte geltend gemacht werden können:
Nach Auffassung des BMI besteht demnach für Menschen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea grundsätzlich keine Rückkehrmöglichkeit (Schreiben des BMI vom 30. Mai 2024, S. 7, https://t1p.de/ei5gf).
Die Europäische Kommission stellt in ihren „Operativen Leitlinien für die Umsetzung des Durchführungsbeschlusses“ (https://t1p.de/0gf2, S. 4) zur Prüfung der Rückkehrmöglichkeit fest:
"In diesem Zusammenhang kann die unmögliche „sichere Rückkehr“ beispielsweise aus einem offensichtlichen Risiko für die Sicherheit der betroffenen Person, aus bewaffneten Konflikten oder dauernder Gewalt, dokumentierten Gefahren der Verfolgung oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung resultieren. Für eine „dauerhafte“ Rückkehr sollte die betreffende Person aktive Rechte in ihrem Herkunftsland oder ihrer Herkunftsregion in Anspruch nehmen können, damit sie Perspektiven für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse in ihrem Herkunftsland/ihrer Herkunftsregion und die Möglichkeit der Reintegration in die Gesellschaft hat. Bei der Beurteilung, ob eine „sichere und dauerhafte“ Rückkehr möglich ist, sollten sich die Mitgliedstaaten auf die allgemeine Lage im Herkunftsland oder der Herkunftsregion stützen. Dennoch sollte betreffende Person individuelle Anscheinsbeweise dafür erbringen, dass sie nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren kann."
In vielen Fällen wird es auf den Einzelfall ankommen, der für die Ausländerbehörde schwierig zu prüfen sein wird. Relevant für die Prüfung können auch Kriterien unterhalb von Abschiebungsverboten sein (etwa wegen Schwangerschaft, Krankheit, familiäre Bindungen, fehlendes Existenzminimum, tatsächliche Unmöglichkeit einer Rückkehr bzw. Abschiebung wegen fehlender Reiseverbindungen), aber auch die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Rückkehr (etwa bei bevorstehender Aufnahme einer Arbeit als Fachkraft bzw. eines Studiums in Deutschland oder nach langer Abwesenheit aus dem ursprünglichen Herkunftsland). Das BMI weist ausdrücklich darauf hin, dass im Fall der begründeten Aussicht auf die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels die Prüfung der Rückkehrmöglichkeit „zurückzustellen“ sei (https://t1p.de/ei5gf, S. 7) und somit eine längerfristige Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden kann.
Insbesondere für Familien mit minderjährigen Kindern und andere schutzbedürftige Personen dürfte für die Zuerkennung des vorübergehenden Schutzes in Deutschland ein erleichterter Maßstab gelten. Denn der Schutz des Kindeswohls muss dabei als ein zentrales Kriterium berücksichtigt werden. Die EU-Kommission schreibt dazu:
"Besondere Aufmerksamkeit sollte den besonderen Bedürfnissen von schutzbedürftigen Menschen und Kindern – insbesondere unbegleiteten Minderjährigen und Waisen – auf der Grundlage des Grundsatzes des Kindeswohls gewidmet werden."
Anders als noch bis Frühjahr vergangen Jahres schließt die Bundesregierung Personen mit einem befristeten Aufenthaltsstatus nun vom vorübergehenden Schutz aus:
"Das BMI hat entschieden, nur denjenigen Personen Einreise und Aufenthalt zu erleichtern, denen europarechtlich zwingend vorübergehender oder anderweitiger nationaler Schutz zu gewähren ist. In der Konsequenz wird auch das nach Artikel 2 Absatz 3 des Durchführungsbeschlusses eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass Staatenlose und nichtukrainische Drittstaatsangehörige ohne Schutzstatus bzw. nachgewiesenes unbefristetes Aufenthaltsrecht in der Ukraine materiell keinen vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG mehr erhalten sollen.
Daher sollen ab dem 5. Juni 2024 für den genannten Personenkreis nach Artikel 2 Absatz 3 des Durchführungsbeschlusses keine Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG mehr erteilt oder verlängert werden." (https://t1p.de/ei5gf, S. 9).
Dies ist eine gravierende Verschlechterung, denn damit bricht die Bundesregierung nicht nur ihr Versprechen, Geflüchtete mit und ohne ukrainische Staatsangehörigkeit gleich zu behandeln. Es führt auch dazu, dass Menschen, die bereits im Besitz der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG sind, diese ab dem 5. März 2025 nicht verlängert bekommen. Stattdessen sollen sie auf andere mögliche Aufenthaltserlaubnisse oder auf das Asylverfahren verwiesen werden.
Politisch ist dieser nachträgliche Ausschluss vom vorübergehenden Schutz daher entschieden abzulehnen. Der EuGH hat allerdings in einem Urteil vom 19. Dezember 2024 entschieden, dass es rechtlich zulässig ist, den vorübergehenden Schutz den nicht unmittelbar vom Durchführungsbeschluss erfassten Personen vorzeitig zu entziehen (EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2024; C-244/24 et C-290/24; https://t1p.de/dx31z).
Es wird nun entscheidend darauf ankommen, für diese Personen spätestens ab dem 5. März 2025 aufenthaltsrechtliche Alternativen zu finden.
Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufenthG sind normalerweise bis zum 4. März 2025 befristet. Aber auch Aufenthaltserlaubnisse, die nur bis Anfang 2024 befristet waren, gelten aufgrund der früheren Fassung der „Ukraine-Aufenthalts-Fortgeltungsverordnung (UkraineAufenthFGV)“ bis zum 4. März 2025 automatisch fort – auch wenn man die Aufenthaltserlaubnis physisch nicht mehr in Händen hat (https://t1p.de/wrbzi). Dies gilt auch für Personen mit einem befristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine (https://t1p.de/ei5gf, S. 10).
Ab dem 5. März 2025 sieht es anders aus: Nach der aktuellen Fassung der UkraineAufenthFGV gelten Aufenthaltserlaubnisse, die am 1. Februar 2025 gültig sind, automatisch bis zum 5. März 2026 nur dann fort, wenn die Person
Das heißt: Bereits erteilte Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufenthG von nicht-ukrainischen Personen, die in der Ukraine einen befristeten Aufenthaltstitel besaßen, gelten nicht automatisch fort!
Daher ist es entscheidend, vor Ablauf der alten Aufenthaltserlaubnis einen Antrag auf eine andere Aufenthaltserlaubnis zu stellen, da ansonsten die Ausreisepflicht eintreten würde. Wenn der Antrag auf die andere Aufenthaltserlaubnis noch während der Geltung des § 24 AufenthG gestellt wird, ist ein Wechsel grundsätzlich möglich; dies regelt § 39 Nr. 1 AufenthV. Wenn die Ausländerbehörde den Antrag nicht sofort bescheiden kann, besteht der rechtmäßige Aufenthalt per Gesetz automatisch fort und es muss eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden (§ 81 Abs. 4 und 5 AufenthG), bis über den Antrag entschieden ist. Mit der Fiktionsbescheinigung besteht weiterhin ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und auch eine Erwerbstätigkeit darf weiterhin ausgeübt werden.
Die Hürden für die anderen Aufenthaltstitel sind jedoch hoch: Neben den jeweiligen spezifischen Voraussetzungen müssen dafür in der Regel der Lebensunterhalt gesichert und die Passpflicht erfüllt sein. Ausnahmen sind in atypischen Fällen möglich, werden aber erfahrungsgemäß selten gemacht. Informationen zu den erforderlichen Einkommen und zur Sicherung des Lebensunterhalts gibt es hier: https://t1p.de/ky08s.
In besonderen Einzelfällen können Aufenthaltserlaubnisse zur Familienzusammenführung oder aus humanitären Gründen infrage kommen. Daneben sind vor allem eine Reihe verschiedener Aufenthaltstitel zum Zwecke der Ausbildung, des Studiums oder der Erwerbstätigkeit zu nennen. Wichtig ist dabei: Der Wechsel in die in diesem Abschnitt dargestellten Aufenthaltstitel wird in der Regel nur gehen, wenn der neue Titel aus dem bestehenden § 24 AufenthG oder aus der Fiktionsbescheinigung heraus beantragt wird. Wenn die Verlängerung des § 24 bereits abgelehnt worden ist und damit Ausreisepflicht eingetreten ist, geht dies normalerweise nicht mehr.
Falls bereits ein Berufsabschluss vorliegen sollte, empfiehlt es sich dringend, sich frühzeitig zu den Möglichkeiten der Anerkennung dieses Abschlusses zu informieren. Hierzu können die Beratungsstellen des IQ Netzwerks Informationen geben: https://www.netzwerk-iq.de/.
Im Folgenden werden diese Aufenthaltstitel mit den jeweils wichtigsten Voraussetzungen dargestellt. Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Aufenthaltstiteln für Ausbildung, Studium oder Arbeit finden Sie in der Broschüre „Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0“ des Paritätischen Gesamtverbands: https://t1p.de/zyy1g
Aufenthaltserlaubnis für die schulische oder betriebliche Berufsausbildung. Es muss sich nicht um eine qualifizierte (also mindestens zweijährige) Beufsausbildung handeln.
Voraussetzungen:
Aufenthaltserlaubnis für das Studium oder für studienvorbereitende Maßnahmen.
Voraussetzungen:
Aufenthaltserlaubnis für die Durchführung notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit oder die Erteilung der Berufsausübungserlaubnis erforderlich sind. Diese Aufenthaltserlaubnis kann nur erteilt werden, wenn ein ausländischer Studien- oder Berufsabschluss vorliegt.
§ 16d AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis für die Teilnahme an Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Sie setzt sich aus mehreren Aufenthaltserlaubnissen zusammen:
Es besteht stets die Berechtigung zu einer Nebentätigkeit von 20 Wochenstunden. Dies gilt für alle Aufenthaltserlaubnisse des § 16d AufenthG, mit Ausnahme von § 16d Abs. 5 AufenthG (zum Ablegen einer Prüfung).
Es besteht die Berechtigung zu einer zeitlich unbeschränkten parallelen Beschäftigung, wenn diese in einem berufsfachlichen Zusammenhang mit dem anzuerkennenden Beruf steht (§. 16d Abs. 2, Abs. 6 AufenthG). Seit dem 1. März 2024 ist hierfür keine Einstellungszusage mehr für die Zeit nach der Anerkennung erforderlich. Hierfür ist die Zustimmung der BA erforderlich, die dafür die Beschäftigungsbedingungen prüft (§ 8 Abs. 2 BeschV). Hierzu einige Beispiele:
Voraussetzungen:
§ 16f AufenthG ist eine Aufenthaltserlaubnis für einen allgemeinen oder einen studienvorbereitenden Sprachkurs
Voraussetzungen:
§ 18a und § 18b AufenthG sind die Aufenthaltserlaubnisse für eine Beschäftigung als Fachkraft, wenn bereits ein anerkannter oder als gleichwertig geltender akademischer oder nicht-akademischer Berufsabschluss vorhanden ist.
Sie werden erteilt für eine Beschäftigung als Fachkraft, für jede qualifizierte Tätigkeit. Nicht möglich sind dabei Anlern- oder Helfer*innentätigkeiten. Vielmehr muss es sich um eine Tätigkeit handeln, für die „Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind, die in einem Studium oder einer qualifizierten Berufsausbildung erworben werden“. Ein inhaltlicher Zusammenhang mit dem Abschluss wird dabei nicht mehr vorausgesetzt. So ist auch in gewissem Maße eine unterqualifizierte Tätigkeit möglich. Beispiele:
Voraussetzungen:
Für die Teilnahme an einem gesetzlich geregelten Freiwilligendienst (z. B. Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr) kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 AufenthG erteilt werden, Voraussetzungen:
Auch für ein Au-Pair kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 AufenthG für max. zwölf Monate erteilt werden, Voraussetzungen:
Informationen zu den Voraussetzungen für einen Aufenthalt als Au Pair gibt es von der Bundesagentur für Arbeit: https://t1p.de/o4dkj. Ein Muster für einen Au-Pair-Vertrag gibt es ebenfalls auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit: https://t1p.de/xzfg.
Es handelt sich um eine Aufenthaltserlaubnis für Personen, die zwar einen ausländischen Berufsabschluss haben, der im Ausland, aber nicht in Deutschland anerkannt ist. Sie können durch Berufserfahrung die fehlende deutsche Anerkennung ausgleichen. Eine Feststellung der Gleichwertigkeit ist dann nicht erforderlich. Hierfür gibt es dann die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 2 AufenthG in Verbindung mit § 6 BeschV.
Voraussetzungen:
Es kann unabhängig von den Regelungen der Beschäftigungsverordnung und unabhängig von der Qualifikation eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 3 AufenthG erteilt werden, wenn an dieser Tätigkeit im Einzelfall „ein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.“ Hierfür ist die Zustimmung der BA erforderlich, die dafür eine Prüfung der Beschäftigungsbedingungen und eine Vorrangprüfung durchführt. Es muss sich nicht um eine qualifizierte Tätigkeit handeln.
Die Hürden hierfür sind aber hoch. Die BA schreibt in ihren Fachlichen Weisungen zur Frage, wann ein arbeitsmarktpolitisches Interesse vorliegen kann: „Ein öffentliches Interesse für die Zustimmung liegt z. B. vor, wenn Arbeitsplätze in dem betroffenen Betrieb oder in anderen Betrieben (z. B. Zuliefer-Betrieben) erhalten oder geschaffen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn in einem Betrieb nicht genügend Fachkräfte vorhanden sind und durch die Beschäftigung eines Ausländers verhindert werden kann, dass dem Betrieb Aufträge entgehen.“ (BA, Fachliche Weisung Aufenthaltsgesetz und Beschäftigungsverordnung, Nr. 19c.0.2)
Für die Prüfung, ob ein regionales oder wirtschaftliches Interesse vorliegt, ist die Botschaft bzw. die Ausländerbehörde zuständig.
In bestimmten Fällen kann diese Aufenthaltserlaubnis auch für nicht-ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine in Frage kommen – nämlich dann, wenn sie bereits eine Arbeit ausüben. So sehen die Anwendungshinweise für die Ausländerbehörde Berlin ausdrücklich die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für diese Personen vor, die bereits seit sechs Monaten arbeiten:
„Gleiches gilt für die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine, die nachweislich über einen befristeten ukrainischen Aufenthaltstitel im Original („TEMPORARY RESIDENCE PERMIT“) verfügen, aber nicht oder ab dem 04.03.2025 nicht mehr unter den begünstigten Personenkreis des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 fallen, und sich nach ihrer Flucht aus der Ukraine hier auf Grund § 81 Abs. 3 Satz 1 AufenthG oder § 24 Abs. 1 erlaubt aufhalten, und bereits seit einem Zeitraum von mindestens 6 Monaten bei einem Arbeitgeber mit Berliner oder Brandenburger Betriebssitz sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und die Begründung einer Ausreisepflicht die Betriebsabläufe erheblich beeinträchtigen könnte. Ein wirtschaftliches öffentliches Interesse ist hier nach Weisung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung stets anzunehmen, denn die Begründung einer Ausreisepflicht würde angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels die Betriebsabläufe erheblich beeinträchtigen.“ (VAB Berlin,
https://t1p.de/i4cw; Nr. 19c.3).
Neben Berlin wendet auch die Ausländerbehörde Bremen diese Regelung in ähnlicher Form an. Diese Argumentation sollte auch in anderen Ausländerbehörden genutzt werden.
In manchen Fällen ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 S. 1 oder 2 AufenthG denkbar – insbesondere, wenn es darum geht, eine gewisse Zeit zu überbrücken, bis z. B. ein Studium, eine Ausbildung oder eine Arbeit in Deutschland aufgenommen werden kann.
§ 17 AufenthG regelt den Aufenthalt zum Zwecke der Ausbildungs- oder Studienplatzsuche und kann ebenfalls eine „Brückenlösung“ für bis zu neun Monate darstellen. Er setzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Aufenthaltserlaubnissen:
Voraussetzungen:
Wenn der frühere § 24 AufenthG schon abgelaufen bzw. abgelehnt worden ist, stehe die bisher genannten Aufenthaltstitel in der Regel nicht mehr offen, sondern die Betroffenen werden auf das Nachholen eines Visumverfahrens verwiesen. In diesem Fall gibt es aber dennoch eine Reihe von Aufenthaltsperspektiven, die dann in Frage kommen:
Die Beschäftigungsduldung ist kein Aufenthaltstitel, sondern eine Duldung, die ausreisepflichtigen Personen erteilt werden soll, wenn sie in einem bestimmten Umfang erwerbstätig sind. Die Beschäftigungsduldung ist eine besondere Form der Ermessensduldung nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG, die in Verbindung mit § 60d AufenthG erteilt wird. Sie gibt Sicherheit vor der Abschiebung. Allerdings setzt die Beschäftigungsduldung voraus, dass man schon ein Jahr geduldet gewesen sein muss. Dies dürften die meisten Vertriebenen aus der Ukraine nicht erfüllen können, da sie bisher im erlaubten Aufenthalt waren.
Die Voraussetzungen für die Beschäftigungsduldung sind unter anderem:
Ausreisepflichtige Personen haben immer die Möglichkeit, eine Eingabe an die Härtefallkommission des jeweiligen Bundeslands zu richten. Alle Bundesländer haben Härtefallkommissionen eingerichtet. Die Härtefallkommission kann dann ein Ersuchen an die Ausländerbehörde richten, der Person – abweichend von den sonstigen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes – eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG zu erteilen.
Es gibt hierzu keine einheitlichen Regelungen und auch die Praxis ist in allen Bundesländern unterschiedlich. Es wird aber in allen Fällen darauf ankommen, die Besonderheit des Einzelfalls und die „Härte“ im Falle eine Ausreise deutlich zu machen und gut zu belegen.
Wichtige Aspekte können hierfür sein:
Der Flüchtlingsrat NRW hat ein hilfreiches Merkblatt erstellt, der auch in anderen Bundesländern bei der Orientierung helfen kann: https://t1p.de/sqvzf.
Bei der Ausländerbehörde kann ein isolierter Antrag auf Feststellung eines Abschiebungsverbots hinsichtlich des ursprünglichen Herkunftslands gestellt werden (§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG; Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG). Es handelt sich dabei nicht um einen Asylantrag beim BAMF, sondern um einen Antrag an die örtliche Ausländerbehörde, die hierfür das BAMF beteiligt.
Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 5 AufenthG
Eine Person darf nicht abgeschoben werden, wenn ihr dadurch die Gefahr einer Verletzung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Rechte droht (§ 60 Abs. 5 AufenthG). In der Praxis ist hier hauptsächlich das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (Art. 3 EMRK) von Bedeutung, insbesondere, wenn die Lebensbedingungen für einzelne Schutzsuchende aufgrund schlechter humanitärer Bedingungen im Herkunftsland einer Verletzung von Art. 3 EMRK gleichkommen. Unter solchen Umständen könnte dann aber vom vorrangigen subsidiären Schutz auszugehen sein, wobei die Abgrenzung umstritten ist.
Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 7 AufenthG
Eine Person darf schließlich nicht abgeschoben werden, wenn ihr im Zielstaat eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht (§ 60 Abs. 7 AufenthG). Diese Regelung kann etwa zur Anwendung kommen, wenn einer Person im Fall einer Abschiebung erhebliche Gesundheitsgefahren drohen. Dies gilt jedoch nur für lebensbedrohliche oder schwerwiegende Krankheiten, die sich durch die Abschiebung akut zu verschlechtern drohen. Nicht erforderlich ist, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in Deutschland gleichwertig ist, und es ist ausreichend, wenn sie nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. Der Anwendungsbereich der Regelung wurde durch die Rechtsprechung und schließlich durch die Gesetzesverschärfung Anfang 2016 (sog. Asylpaket II) stark eingeschränkt. Zudem muss seit der aktuellsten Gesetzesverschärfung durch das 2019 verabschiedete Migrationspaket eine bestehende Erkrankung durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht werden (vgl. § 60 Abs. 7 S. 2 i. V. m. § 60a Abs. 2c S. 2 und 3 AufenthG).
Wenn der vorübergehende Schutz bzw. die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG nicht zuerkannt bzw. nicht verlängert werden und auch die genannten anderen Aufenthaltserlaubnisse nicht in Frage kommen, kann insbesondere für nicht-ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine ein Asylantrag notwendig bzw. sinnvoll sein. Dieser Antrag muss beim BAMF gestellt werden, die Prüfung bezieht sich nicht auf die Situation in der Ukraine, sondern im ursprünglichen Herkunftsland. Wenn ein Asylantrag gestellt wird, umfasst dieser auch die Prüfung eines nationalen Abschiebungsverbots, dies kann dann nicht (zusätzlich) bei der Ausländerbehörde geltend gemacht werden.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Asylverfahren negative Auswirkungen haben kann (eventuell Verpflichtung zum Leben in Erstaufnahmeeinrichtungen, lange Sperrfristen für die Arbeitserlaubnis, Sperrwirkungen des § 10 Abs. 1 und 3 AufenthG für die spätere Erteilung von Aufenthaltstiteln usw.). Eine individuelle Beratung durch spezialisierte Beratungsstellen und/oder durch fachkundige Anwält*innen ist daher von großer Bedeutung.
Aus einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist gemäß § 39 S. 1 Nr. 1 AufenthV grundsätzlich, auch ohne zwischenzeitliche Ausreise und Nachholung eines Visumverfahrens, der Wechsel in jede andere Aufenthaltserlaubnis möglich. Dies kann etwa von Bedeutung sein, wenn der vorübergehende Schutz nicht verlängert wird, oder auch vorzeitig, wenn die Voraussetzungen für eine „bessere“ Aufenthaltserlaubnis erfüllt sind (etwa für einen Aufenthalt als Fachkraft gemäß § 18a oder § 18b Abs. 1 oder aus familiären Gründen gemäß § 30ff AufenthG).
Allerdings sieht § 19f AufenthG Sperren für bestimmte Aufenthaltstitel vor: